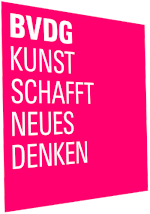Karl Rössing
Die Kunst des Grafikers und Hochschullehrers Karl Rössing (1897 – 1987) wird zwischen Surrealismus und Neuer Sachlichkeit eingeordnet. In Summe lässt sich feststellen, dass Rössing, der im Sinne des Deutschen Werkbundes – Form follows Function – ausgebildet wurde, die während seiner Lebenszeit vorherrschenden Stile – Jugendstil, Expressionismus, Kubismus, Realismus, Futurismus und eine Prise Historismus – einsetzte, teils mixte und nebeneinander gebrauchte. In der persönlichen Auseinandersetzung mit den Stilen einer Zeit gelangte Rössing zu einer Stilsynthese, die seinen ganz persönlichen Stil ausmachte.
Von 1913 bis 1917 studierte Rössing an der Königlichen Kunstgewerbeschule München. Bereits 1915 hatte er seine erste Ausstellung in München, 1916 wurden erste Arbeiten veröffentlicht und 1917 erhielt er einen Illustrationsauftrag vom Kunstförderer Emil Kugler. Zu dieser Zeit hatte Rössing den Holzstich als sein ureigenstes Metier entdeckt, den er erst in den 1950er Jahren mit dem Linolschnitt ablöste.
In der Zeit von 1919 bis 1921 hatte Rössing einige wichtige Ausstellungsbeteiligungen, z.B. bei der Neuen Sezession in München (1919) und der „Internationalen Schwarz-Weiß-Ausstellung“ (1921) der Künstlervereinigung „Der Wassermann“. Außerdem arbeitete er auf Einladung des Herausgebers Joseph August Lux mit an der Zeitschrift „Kunst- und Kulturrat“.
1921 wurde Rössing an die Folkwangschule in Essen für die Abteilung Buchgewerbe und Graphik berufen, 1926 dann zum Leiter der Fachklasse und ordentlichen Professor ernannt. In seinen ersten Jahren in Essen arbeitete er außerdem sehr erfolgreich als Buchillustrator und 1925 war er an der Ausstellung „Neue Sachlichkeit“ in Mannheim beteiligt.
Ab 1927 ordnete Rössing seine teils kritischen Holzstiche und Lithographien nach Themenbereichen. Sie wurden in Büchern und Ausstellungen, in eher konservativen wie auch linksgerichteten Zeitschriften veröffentlicht.
Nachdem Rössings Vertrag in Essen 1931 nicht mehr verlängert wurde konnte er sich 1934 erfolgreich an der Staatlichen Hochschule für Kunst in Berlin als Dozent für die Klasse Malen und Zeichnen bewerben. 1939 wurde er dort zum Professor auf Lebenszeit ernannt
.
Diese „Karriere“ während der Herrschaft der Nationalsozialisten erfolgte vor einem bipolaren, wohl auch opportunistischen Hintergrund. Bereits 1933 hatte sich Rössing erfolglos um die Mitgliedschaft in der NSDAP beworben. 1937 waren seine Illustrationen zu „Münchhausen“ und seine Graphik „Einwandfreie Prozessführung“ beschlagnahmt worden. Ebenfalls 1937 wurde er von einem Studenten diffamiert und hatte sich, als Gegenstrategie, erneut um die NSDAP Mitgliedschaft beworben. Im Auftrag des Reichsluftfahrtministeriums, Abteilung Kunstbeschaffung, bereiste Rössing 1941 Kreta. Er malte historisierende Bilder, die dem „Zeitgeist“ gefielen, gleichzeitig aber auch erstellte er zeitkritische Grafikserien wie z.B. „Fallschirmjägerfriedhof auf Kreta“ oder „Blätter zum Tod“.
1944 wurde Rössings Wohnhaus in Berlin als Folge der Bombenangriffe zerstört und Rössing wurde zum Kriegsdienst verpflichtet. Reflektionen zu seinen Kriegsbeteiligungen und der Nachkriegszeit finden sich in Rössings Briefen, u.a. auch seinem seit 1928 gepflegten Briefverkehr mit Alfred Kubin.
Nach der Kriegsgefangenschaft war Rössing Mitbegründer des Kulturbundes, Ortsgruppe Blankenburg, und kurzzeitiger Vorsitzender des Kunstkreis Blankenburg. 1947 erhielt er eine Berufung an die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, die er von 1953 bis 1955 als Rektor leitete. Rössing war Mitglied im Deutschen Künstlerbund und 1953, u.a. gemeinsam mit Frans Masereel (1889 – 1972) und Johannes Lebek (1901 – 1985), Gründungsmitglied der „XYLON. Internationale Vereinigung der Holzschneider“. (Zu den Mitgliedern der XYLON gehörten u.a. Uwe Bremer, HAP Grieshaber, Erich Heckel, Gerhard Marcks, Ewald Mataré, Otto Pankok und Max Pechstein).
Auf eigenen Wunsch wechselte Rössing 1960 in den vorzeitigen Ruhestand und zog erst nach München, nach dem Tod seiner Frau 1977 nach Marchtrenk in Österreich.
Zu seinem 80sten Geburtstag zeigte die Stuttgarter Akademie eine durch Arbeiten seiner „Schüler“, dazu gehörten u.a. Bernd Becher, Robert Förch, Wolfgang Gäfgen, Friedrich Meckseper und Malte Sartorius, bereicherte Retrospektive.
Beheimatet im „Westen“ hat Rössing immer wieder den Austausch mit der DDR gesucht und wurde dort auch regelmäßig ausgestellt. Dem Kunstmarkt und der Politik gegenüber verhielt sich der Österreicher kritisch und distanziert. Rössings Arbeiten befinden sich zu einem großen Teil als Stiftungen in deutschen und österreichischen öffentlichen Sammlungen, aber ebenfalls im British Museum in London, dem Puschkin Museum in Moskau und auch der Französischen Nationalbibliothek in Paris.